Vor einigen Wochen nahm ich mir vor, wieder mehr Bücher japanischer Autorinnen und Autoren zu lesen. Dementsprechend bestellte ich mir vor kurzem einen ganzen Stapel interessanter Bücher in meine örtliche Buchhandlung, die ich hier nun nach und nach rezensieren werde.
Der Plot von „Das gelbe Haus“ von Mieko Kawakami, übersetzt von Katja Busson, sprach mich sofort an: Laut Klappentext verweben sich in dem Buch die Schicksale von vier Frauen, die gemeinsam im selben Haus wohnen und sich ein besseres Leben erhoffen. Was mir aufgrund des Klappentextes nicht sofort klar war: wie tief das Buch in die Welt von Armut bedrohter Menschen, Krimineller und Kleinkrimineller im Tokyo der neunziger Jahre einstiegt.
Trotzdem war gerade dieses Setting sehr spannend für mich. Ich selbst habe in den frühen zweitausender Jahren selbst in Japan gelebt. Und obwohl ich mich nicht in den im Buch beschriebenen Kreisen bewegt habe, habe ich doch viele Dinge, wie die Gyaru-Kultur und allgemein die Atmosphäre der damaligen Zeit, durchaus wiedererkannt und hatte so viel Spaß beim Lesen und Erinnern.
Leider wies das Buch – in seiner deutschen Übersetzung – aus meiner Sicht einige handwerkliche Schwächen auf, die mir das Lesen teilweise sehr erschwert haben. Die deutschen Sätze sind häufig verschachtelt und unnötig komplex, obwohl diese im japanischen Original gar nicht so komplex sind. (Ja, ich habe beide Versionen verglichen.) Einige japanische Ausdrücke werden weder übersetzt noch erklärt und man fragt sich als Leser, ob einem nun gerade relevante Informationen entgehen. Andere Ausdrücke werden ebenfalls nicht übersetzt, dann aber ausgiebig im Glossar erläutert, obwohl sie zum Plot selbst nichts beitragen.
Warum zum Beispiel werden so viele unterschiedliche Arten von japanischen Lebensmitteln erläutert? Ist es wichtig, was genau „nabe“ ist oder können die Protagonisten nicht auch einfach vor einem „Eintopf“ sitzen? Kann „yakiniku“ nicht einfach zu „Grillfleisch“ werden?
Andererseits werden die Strukturen der Yakuza und kleinkrimineller Straßengangs nur am Rande erklärt, obwohl ein Verständnis dieser an manchen Stellen entscheidend für das Verständnis des Textes ist. Yakuza-Clans nutzen im Japanischen bewusst eine Sprache, die Mitglieder wie Teile einer Familie bezeichnet. Es gibt Väter, Söhne, (höher gestellte) große Brüder, (niedriger gestellte) kleine Brüder. Zum Teil wird das in der deutschen Übersetzung aber nicht getrennt von tatsächlichen (blutsverwandten) Familien. Mir ist klar, dass diese Überschneidungen auch im japanischen Original teilweise bewusst gesetzt werden, um eben „echte“ Familien mit „Wahl-“ oder „Ersatzfamilien“ zu vergleichen. Trotzdem hätte ich mir hier etwas mehr Feingespür bei der Übersetzung gewünscht.
Grundsätzlich hätte ich mir hier durchweg Fußnoten statt eines Glossars gewünscht – in Kombination mit einer sparsameren Nutzung von unübersetzten und dann im Glossar erläuterten Ausdrücken.
Sobald ich zu einem gewissen Grad in den Stil hineingekommen und über die (meiner Meinung nach bestehenden) sprachlichen Schwächen hinwegsehen konnte, hat mir das Buch gut gefallen. Obwohl man schon am Anfang (grob) das Ende kennt, entstehen immer wieder spannende neue Wendungen. Auch wie die Charaktere vorsichtig, nach und nach eingeführt werden, finde ich ausgesprochen gut gelöst.
Alles in allem muss ich sagen: Mir hat das Buch gut gefallen. Beim nächsten Mal würde ich es aber im japanischen Original lesen – oder in einer optimierten Übersetzung.
Fazit: ★★★☆☆
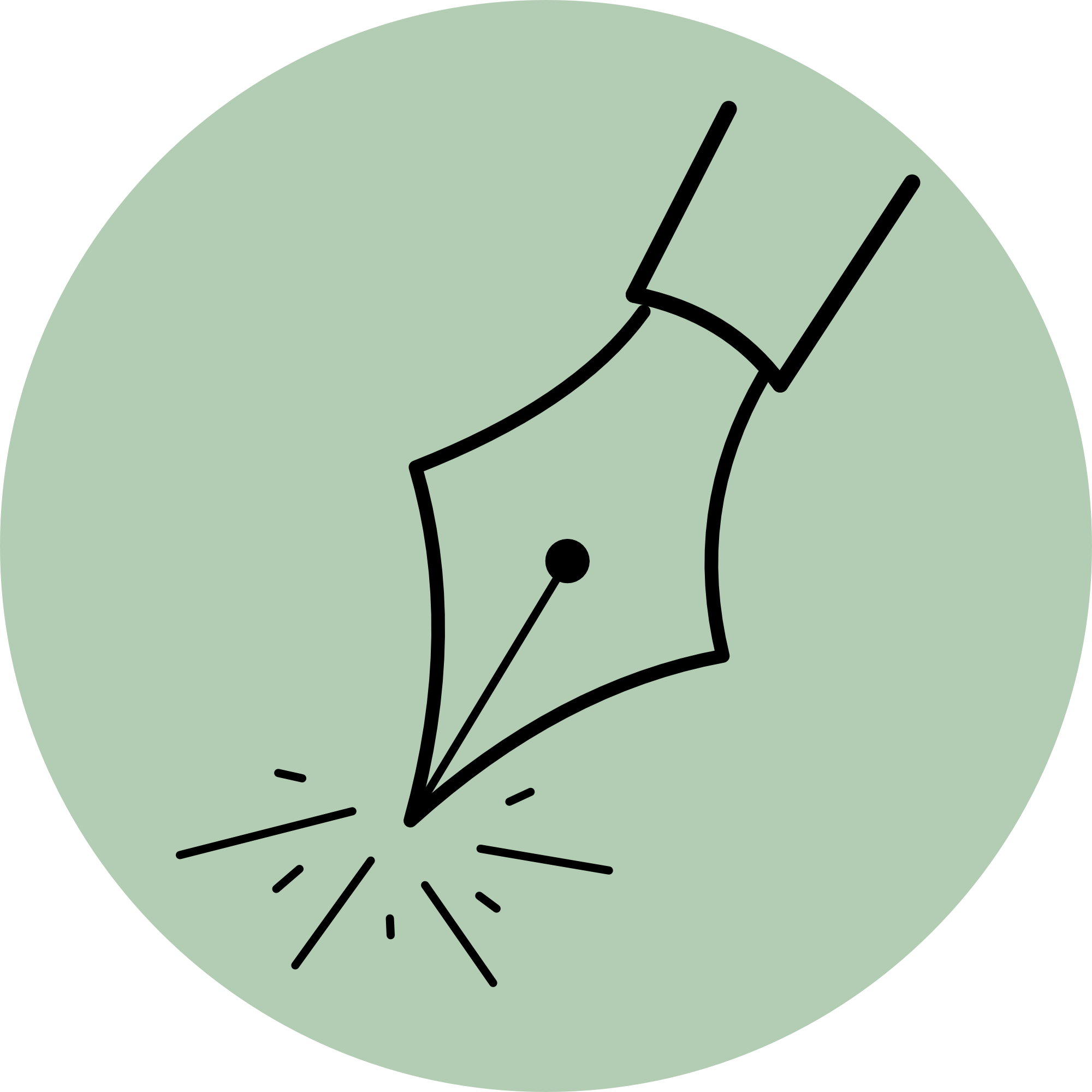

Schreibe einen Kommentar